Als Transport die größte Knappheit war, musste die Eisenbahn gebaut werden; durch die Wissensflut musste der Computer vorangerbacht werden. Was ist jetzt knapp? Während viele die Zukunft in neuen Technologien suchen, ist jetzt der größte Teil der Arbeit immaterielle Gedankenarbeit – und die hat ganz neue Spielregeln für wirtschaftlichen Erfolg.
Als die englischen Unternehmer nicht mehr hinterherkamen, ihre Bergwerke zu entwässern und Blasebälge für die Eisenschmelze zu betätigen, beauftragten sie den wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität Edinburgh, eine Dampfmaschine zu entwickeln – James Watt tüftelte zwölf Jahre lang, bis diese endlich ausreichend effizient war. Die Eisenbahn wurde nicht deshalb gebaut, weil die Leute keine Lust mehr hatten, mit der Kutsche zu fahren.
Sondern weil die fehlende Transportmöglichkeit die damals größte Bremse für das Wirtschaften war – die Unternehmer mussten sie gegen den anfänglichen Widerstand der Gesellschaft durchsetzen. Als die Informationsflut explodierte und ihre Verwaltung mit Karteikästen nicht mehr zu bewältigen war, gab es einen ökonomischen Druck, den Computer voranzubringen und weiterzuentwickeln.
Erfindungen wurden weltweit gleichzeitig gemacht, weil die Menschen vor denselben Wachstumsgrenzen stehen, schrieb der Ökonom Nikolai Kondratieff. An den relativ knappsten Produktionsfaktoren ist der Veränderungsdruck, der in die Zukunft weist. Und heute? Regenerative Energien helfen dem Klima, aber sie ersetzen nur Kohlenstoff basierte Energiequellen durch andere, sind kein zusätzlicher Wohlstand. Industrie 4.0 ist ein weiterer Entwicklungsschritt der Informationstechnik, setzt aber nicht an der heutigen Knappheit an – unsere Häuser und Wohnungen sind schon gesteckt voll von unten bis oben, wir haben gar keinen Mangel an Gütern.
Und sie ist viel mehr als nur ein technisches Problem: Es reicht nicht, Technik A durch Technik B zu ersetzen, sich bequem zurückzulehnen und so weiter zu machen wie bisher.
Wirtschaftswachstum in die gedachte Welt hinein
Denn hinter Maschinen, die sich selber steuern, mit Ersatzteilen und dem Lager kommunizieren – dahinter steckt vor allem die geistige Leistung von Menschen, die sich überlegen müssen, was etwas wann und wie können muss. Damit geht uns die bezahlte Arbeit auch nicht aus, denn Arbeit ist, Probleme zu lösen. Sie wandelt sich in dem großen Umbruch von der Industriegesellschaft zur Economy of Knowledge: Arbeit ist nicht mehr, mit Händen die materielle Welt direkt zu bearbeiten – schrauben, fräsen, montieren haben uns die Roboter weitgehend abgenommen. Arbeit ist jetzt, in der gedachten Welt eine Wertschöpfung zu leisten – planen, organisieren, entwickeln, analysieren und entscheiden, gestalten, verstehen, was der Kunde meint; in der gigantischen Wissensflut die Informationen heraussuchen, die man gerade braucht, um ein Problem zu lösen.
Damit gibt es zwar Grenzen des Wirtschaftswachstums, was Kühlschränke oder Autos angeht, nicht aber für die Wirtschaft an sich: Sie wächst in die gedachte Welt hinein, und dort gibt es keine Grenzen des Wachstums. Ob jemand arbeitslos zu Hause sitzt oder stattdessen Vortragsfolien designet oder für jemanden recherchiert, macht vom Ressourcenverbrauch keinen großen Unterschied; für den Wohlstand sind das aber zusätzliche Leistungen. Deswegen brauchen wir auch kein anderes Wirtschaftssystem, sondern Unternehmen und eine Wirtschaftspolitik, die die Wertschöpfung in der gedachten Welt erschließt.
Strukturierte Informationsarbeit produktiver machen
Wie wir materielle und energetische Prozesse sowie zuletzt strukturierte Informationsarbeit produktiver machten, das wissen wir und ist weitestgehend ausgereizt; selbst die Schwellenländer haben in diesen Bereichen den größten Teil ihres Weges zurückgelegt. Die Aufgabe, vor der wir nun stehen, ist, jenen Teil der Arbeit effizienter zu gestalten, bei dem es um das Anwenden von unscharfem, unstrukturiertem Wissen geht. Denn für einen realwirtschaftlichen Kondratieff-Ökonomen (siehe Teil 1) hängt die Konjunktur vorrangig von dem Maß ab, in dem Ressourcen eingespart bzw. die gesamtgesellschaftliche Produktivität gesteigert wird.
Das ist ein völlig anderer Blick als die meisten Schulen der Wirtschaftswissenschaft, die sich auf monetäre Indikatoren und Stellgrößen konzentrieren: Nicht das Geld für den Bau von Eisenbahnen oder für Fahrkarten trieb den Eisenbahn-Kondratieff an. Sondern weil man so Ressourcen und viel Zeit einsparte, in der man etwas anderes, Zusätzliches arbeiten konnte – das war das Wachstum. Nicht das Geld für Gesprächsgebühren von Handys treibt die Wirtschaft. Sondern weil man im Zug sitzend am Smartphone arbeiten oder sich effizienter abstimmen kann, steigt die Produktivität – das lässt einen die Zeit besser nutzen; die realen Effizienzgewinne erzeugen das Wachstum.
Nicht die Honorare für Mediatoren vermehren den Wohlstand, sondern wenn zwei Abteilungsleiter wieder miteinander reden und Informationen fließen, so dass man doch noch zu der großartigen Lösung kommt – das erhöht die Leistungsfähigkeit. Und Gesundheit wird nicht Wachstumsmotor, weil wir wegen der vielen Alten noch mehr Geld für Medikamente und Stützstrümpfe ausgeben. Sondern wenn wir den Stress aus dem Arbeitsleben nehmen, und bei weniger Arbeitslast flexibler viel länger arbeiten, dann ist der zusätzliche Wohlstand die zusätzlich erbrachte Leistung, die längere produktive Lebensarbeitszeit und die bessere Amortisierung des Bildungskapitals.
Eigene Erfolgsmuster
Lange Strukturzyklen sind aber nicht nur ein ökonomischer, sondern auch ein gesamtgesellschaftlicher Reorganisationsprozess: Jeder von ihnen hat seine eigenen Erfolgsmuster, um die neue Realkostengrenze zu überwinden und das nächste technologischen Netz optimal zu nutzen: Managementmethoden, Firmenstrukturen, Bildungsanforderungen. Wer wie England um 1800 das neue Netz rund um Dampfmaschine und dann um Eisenbahn nutzt, ist am produktivsten und steigt auf; wer wie England dann aber an den alten Erfolgsmustern festhält, wird vom Deutschen Reich rasant überholt, das in die neue Basisinnovation rund um den elektrischen Strom investiert.
Die Sowjetunion konnte Weltmacht sein, als es um billige Erdölenergie ging, musste aber zusammenbrechen, als sie mit ihren starren Strukturen die neue Realkostengrenze der Informationsflut nicht überwinden konnte, wie es der Computer tat. Japan stieg auf, weil es Computer anwendete und weiterentwickelte, aber stagniert nun, weil die neuen Knappheiten im immateriellen Bereich der Wissensarbeit liegen, die sich nicht mit Technology erschließen lassen.
Zum ersten Mal stehen wir vor einer immateriellen Knappheitsgrenze in einer zunehmend immateriellen Wirtschaft: Dass Informationsarbeit nicht ausreichend effizient ist, dafür sprechen viele Indikatoren wie innere Kündigung oder Kommunikationsprobleme – die Berufstätigen geraten vor allem mit ihrem Sozialverhalten unter den Veränderungsdruck, effizienter zusammenzuarbeiten, um Wissen besser zu nutzen. Das ist das neue Paradigma, das wir nun erschließen müssen, wenn sich die Weltwirtschaft stabilisieren soll: Die Arbeit in der gedachten Welt so zu gestalten, dass sie weit produktiver wird als heute. => dritter Teil am kommenden Freitag.
483 mal gelesen



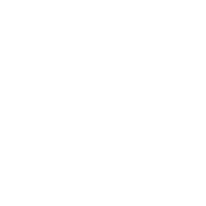

Kommentare