Technologischer Wandel verändert unsere Arbeitswelt schon heute fundamental. Aber vermutlich stehen wir erst am Beginn einer immer schneller fortschreitenden Entwicklung. Das kann positive Folgen für unser Leben haben – oder katastrophale
Die Zeit, in der wir ständig auf Bildschirme schauen, geht gerade zu Ende. Als Apple die Kopfhörerbuchse am iPhone wegließ und Nutzern empfahl, drahtlose Knöpfe im Ohr zu tragen, war das mehr als nur die Befreiung von ein paar Kabeln – vielmehr der erste Schritt in eine Welt von sprachgesteuerten Systemen und durch künstliche Intelligenz gesteuerten persönlichen Assistenten.
Amazon Echo und Google Home stehen in immer mehr Haushalten. Apples Siri und Microsofts Cortana lernen schnell dazu. Im besten Fall kann das bedeuten, dass wir künftig wieder mehr von unserer Umwelt mitbekommen, wie Graeme Devine, Gründer von Magic Leap, prognostiziert. Er will mit seiner Augmented-Reality-Technologie die Menschen aus ihren isolierten Blasen herausholen.
Ein faszinierender Gedanken. Und zugleich ein erschreckender. Denn wenn wir uns zunehmend in diesen Welten bewegen und wenn sie dank Mixed Reality ein selbstverständlicher Teil unseres Lebens werden, dann sind wir in Zukunft vielleicht nie mehr allein.
Wenn die Brillen kleiner werden und die intelligenten Assistenten uns per Knopf im Ohr ständig begleiten, können wir dann überhaupt noch jemals abschalten? Dann wäre der scheinbare Überfluss an digitalen Kanälen und Stimuli, wie wir ihn derzeit erleben, nur ein kleiner Vorgeschmack auf eine Welt, in der wir permanent kommunizieren, teilen, kollaborieren – und eben: arbeiten. Für viele wäre das eine Dystopie, andere freuen sich auf so eine Zukunft.
Was aber alle interessieren muss:
Je kleiner und unauffälliger die Geräte werden, desto größer und mächtiger wird die Infrastruktur im Hintergrund, die diese Services ermöglicht. Server, Bandbreite, Rechenkraft und Speicher, die nötig sein werden, um vernetzte virtuelle Welten für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stehen »sind jenseits von Big Data«, wie Kevin Kelly sagt: »das ist Ginormous Data.« Per Definition wird alles, was in einer VR- oder MR-Umgebung passiert, getrackt, also aufgezeichnet und ausgewertet. Je präziser jede Bewegung verfolgt werden kann, desto überzeugender ist die Illusion.
Das heißt aber eben auch, dass die Dinge, die wir anschauen, die Orte, die wir besuchen, die Interaktionen mit anderen Nutzern und der psychologische Zustand, in dem wir uns dabei befinden, aufgezeichnet und ausgewertet werden, um die virtuelle Erlebnisse noch besser an unsere Erwartungen und Vorlieben anzupassen.
Und genau diese extrem persönlichen Daten – riesige Mengen an Daten – werden auch für andere interessant sein. Mindestens für Unternehmen, die uns etwas verkaufen wollen. Potenziell auch für Geheimdienste, Regierungen, wenn sie gehackt werden, für Terroristen – und für Arbeitgeber.
Schon heute heißt einer der heißesten Trends unter Personalberatern in den USA People Analytics, also das Auswerten von Daten über Mitarbeiter, um Muster zu erkennen und darauf zu reagieren. Ich habe am MIT in Boston Ben Waber getroffen, einen der Vordenker dieser Bewegung und Autor des gleichnamigen Buches. Waber hat auf Basis seiner Forschungsarbeit eine Firma gegründet, die im Auftrag von Unternehmen Bewegungs- und Kommunikationsmuster ihrer Angestellten analysiert. Waber verdient also mit dem Messen der persönlichen Daten von Wissensarbeitern sein Geld.
Glaubt man ihm, ist diese Bewegung erst am Anfang
Glaubt man den Beratern von PricewaterhouseCoopers, die sich ausführlich mit dem Thema beschäftigen, dann haben in den USA bereits sehr viele Unternehmen die Möglichkeiten erkannt, die in solchen Verfahren stecken. Die Chefs von 86 Prozent aller US-Unternehmen, so das Ergebnis einer PwC-Befragung, halten den Einsatz von oder zumindest die Beschäftigung mit People Analytics innerhalb der kommenden drei Jahre für ein wichtiges strategisches Ziel. Und 46 Prozent hätten bereits entsprechende Lösungen im Einsatz.
Bekannte Anwender sind laut Recherche der Fachzeitschrift Computerwoche Unternehmen wie Qualcomm, Boeing, Symantec, Walmart oder General Motors. In Deutschland seien Datenschutzbedenken und damit verbundene Ängste der Hauptgrund für die Zurückhaltung und das Informationsdefizit bei diesem Thema.
Keine flächendeckende Technik
Hierzulande ist jede Auswertung persönlicher Daten, die eine Zuordnung zu einer bestimmten Person ermöglicht, nur mit Zustimmung des Betroffenen und/oder des Betriebsrats möglich. »Dem drohenden Konflikt gehen heute noch viele Unternehmen aus dem Weg, indem sie die Finger ganz von People Analytics lassen«, so die Computerwoche. Die Technik werde bei uns frühestens in zehn Jahren flächendeckend eingesetzt.
Auch wenn es offenbar noch etwas dauert – diese Entwicklungen werden kommen. Virtual und Mixed Reality werden sie noch mal dramatisch verstärken. »Wenn Smartphones Überwachungsgeräte sind, die wir freiwillig bei uns tragen, dann werden virtuelle Welten ein totaler Überwachungsstaat, den wir freiwillig besuchen«, sagt Kevin Kelly, der nicht gerade im Verdacht steht, technophob zu sein.
Auswirkungen auf unser Leben
Tatsächlich hat dieses Thema weitgehende Konsequenzen, die geradezu philosophische Fragen aufwerfen. Der US-amerikanische Technologiekritiker John Havens hat sich in seinen Arbeiten stets mit der Thematik beschäftigt, wie Technologie unser Leben verändert und wie wir es in einer zunehmend von Automatisierung und künstlicher Intelligenz geprägten Arbeitswelt schaffen können, unsere individuellen Präferenzen und Vorlieben zu kommunizieren und zu bewahren.
Havens hat bereits zwei Bücher zu diesen Themen verfasst, schreibt regelmäßig für die bekannte Technologiewebsite Mashable sowie für die britische Tageszeitung The Guardian und arbeitet als Executive Director der Global Initiative for Ethical Considerations in the Design of Autonomous Systems – einem Thinktank.
Havens ist für mich einer der klügsten und warmherzigsten Denker zum Thema Technologie, Soziologie und Kultur weltweit – darum habe ich ihn kontaktiert, um herauszufinden, ob die Zukunft aus VR und virtuellen Assistenten eher positiv oder negativ zu bewerten ist. Und welche Verantwortung Unternehmen in dieser neuen Welt tragen.
Es kommt immer darauf an, für wen man arbeitet
Havens sieht die Gefahr, dass wir Menschen bereits heute kaum in der Lage sind, unsere Geräte auch einmal auszuschalten. Die neuen Technologien aber werden unsichtbar sein, weil man sie nur über seine Stimme steuert. Oder sie werden als permanente zusätzliche Ebene Teil unserer Realität. Es wird uns also noch schwerer fallen als heute, technikfreie Zeiten in unserem Tagesablauf zu definieren und zu verteidigen.
Dazu kommt aus seiner Sicht, dass die Hersteller dieser Geräte und Dienste ein großes Interesse daran haben, 24 Stunden am Tag unsere Daten zu sammeln. Immerhin kann er sich vorstellen, dass es auch praktisch ist, wenn man künftig beispielsweise in der Dusche stehend einem Algorithmus seine besten Ideen diktieren kann.
»Es kommt immer darauf an, für wen man arbeitet. Für smarte und progressive Organisationen reicht es, Mitarbeitern ein Ziel und einen Zeitrahmen zu geben – und dann ist es egal, ob man an seinem Schreibtisch sitzt oder über die neuen Geräte permanent erreichbar ist.« Das kann dann mit den neuen Tools auch eine positive, befreiende Wirkung haben. »Wenn dein Arbeitgeber aber eine Kultur des Misstrauens und der Überwachung pflegt, dann machen die neuen Technologien in Zukunft alles noch sehr viel schlimmer.«
Ungünstige Allianz
Denn auch in Havens’ Augen treffen bereits heute zwei Entwicklungen zusammen und formen eine unglückliche Allianz: Während in der Wirtschaft die Fixierung auf Wachstum – idealerweise gar exponentielles Wachstum – unvermindert anhält, nimmt die Digitalisierung des Arbeitslebens – und damit die kommunikative Überlastung des Einzelnen, das Always-On – zu.
»Es klingt gut zu sagen, dass die Technologie den Arbeitnehmer emanzipiert. Wenn diese Tools aber vor allem dazu benutzt werden, kontinuierlich die Produktivität der Unternehmen zu erhöhen, werden sich die Menschen früher oder später dem Druck ausgesetzt sehen, ständig zu arbeiten«, so Havens. »Solange Organisationen sich nicht umfassend und nachhaltig für ihre Mitarbeiter verantwortlich fühlen – also auch für das emotionale, mentale und physische Wohlergehen, für Balance und Auszeiten –, sind Regelungen, auch mal von unterwegs oder zu Hause aus arbeiten zu können, zu kurz gedacht und lösen die Probleme nur vorübergehend.«
Für ihn gibt es eine Sollbruch- stelle, die Organisationen festlegen müssen: An welchem messbaren Punkt laufen ihre Mitarbeiter auf voller Kapazität, liefern ihre bestmögliche Arbeit ab und haben gleichzeitig das Gefühl, dass ihre Jobs und ihr Leben einen Sinn haben? Geht ein Arbeitgeber über diesen Punkt hinaus, brennen die Menschen aus.
Um mehr über diese Zukunftsvisionen herauszufinden, habe ich dann mit einem erklärten Futuristen gesprochen, der zugleich so bodenständig ist, dass er nicht nur wolkige Thesen von sich gibt, sondern begründete Aussagen darüber treffen kann, was diese Entwicklungen für Unternehmen und für unser Arbeitsleben konkret bedeuten können. Und was wir heute tun müssen, um morgen nicht vom rasanten Wandel überrascht zu werden.
Eigenartigste Erwachsenenbildungsinstitution weltweit:
der Singularity University in Kalifornien. Gegründet wurde sie 2009 vom Erfinder Ray Kurzweil, der einerseits unumstritten geniale Produkte wie Lesemaschinen für Blinde oder den nach ihm benannten Synthesizer erfunden hat, heute aber eher mit kontroversen Thesen über Unsterblichkeit und Maschinenintelligenz von sich reden macht und zuletzt bei Google anheuerte.
Die Singularity University ist einer jener Orte, an denen sich vielleicht am klarsten herauskristallisiert, was der Technologiekritiker Evgeny Morozov den Solutionism von Silicon Valley nennt: die Vorstellung, dass man alle Probleme der Menschheit mit Technik lösen könne.
Exponentielles Wachstum der Technologie
Die Anhänger des Singularity-Gedankens generalisieren Moore’s Law, also das Gesetz, dass sich die Leistungsfähigkeit von Computerchips alle zwei Jahre verdoppelt: Weil die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts im digitalen Zeitalter nicht linear, sondern exponentiell wächst, ist die Technik von morgen doppelt so gut wie heute, übermorgen 4-mal so gut, dann 8-mal, 16-mal …
Das Wachstum beschleunigt sich also immer schneller, bis jener Punkt erreicht ist, ab dem – so Kurzweil und seine Apologeten – Ungeheuerliches passieren wird: Maschinen verbessern sich selbst. Unser Leben verlängert sich schneller, als wir altern. Wir gehen also, glaubt man dieser Theorie, mit großen Schritten auf eine Welt zu, die wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können, die wir aber – weil wir immer älter, wahrscheinlich sogar unsterblich werden – noch erleben werden.
Schöne, verwirrende neue Welt.
Nun muss man nicht jedes extreme Gedankenspiel der Singularity-Bewegung plausibel finden. Aber eine nahende Arbeitswelt, die so sehr nach Science-Fiction klingt, kann man tatsächlich am besten mit Techno-Utopisten aus Kalifornien diskutieren.
Ein komplett von Mixed Reality und sprachgesteuerter künstlicher Intelligenz gesteuerter Arbeitsalltag klingt auch nicht verrückter als Kurzweils Konzept von Gehirnen, deren Inhalt auf Festplatten hochgeladen wird. Ich rufe Salim Ismail an, den Mitgründer und Executive Director der Hochschule. Salim lebt eigentlich in Kalifornien, lässt sich aber auf einer New Yorker Telefonnummer anrufen.
Als ich ihn darauf anspreche, sagt er, nein, er sei gerade weder an der West-, noch an der Ostküste der USA, sondern in seinem Geburtsland Kanada. Da seine Telefonate über Google laufen, sagt die Telefonnummer nichts mehr über seinen Aufenthaltsort aus. Schöne, verwirrende neue Welt.
Äußerst positive Arbeitswelt
Ismail ist – wie nicht anders zu erwarten – ein großer Fan der neuen Technologien, kann an der ganzen Sache wenig Problematisches erkennen, wirkt verwundert und zunehmend leicht genervt von meiner andauernden deutschen Skepsis. Für ihn ist die automatisierte und von Algorithmen getriebene neue Arbeitswelt komplett positiv:
»Immer wenn ich etwas wiederholt tue, wird die künstliche Intelligenz im Hintergrund das erkennen, lernen und übernehmen. Dadurch habe ich mehr Zeit und Freiheiten, kreative Arbeit zu tun.« Außerdem seien die neuen Werkzeuge ja dramatisch besser darin, Informationen zu verarbeiten. »Wir Menschen sind sehr limitiert in unseren kognitiven Fähigkeiten, Daten zu analysieren. Wir haben alle möglichen Vorurteile, Befangenheiten, machen immer die gleichen Fehler. Künstliche Intelligenz ist da erheblich objektiver. Je mehr Arbeit wir also an sie abgeben, desto besser.«
Dominanz der Technologien?
Er glaubt auch nicht, dass durch die neuen Technologien Arbeit unser Leben zunehmend komplett dominieren wird – ganz im Gegenteil.
»Vor tausend Jahren haben die Menschen 20 Stunden am Tag auf dem Feld gearbeitet, nur um genügend Essen auf dem Tisch zu haben. Überlegen Sie mal, wie viel unserer Zeit bereits jetzt durch den Einsatz von Technologie frei geworden ist. Wir arbeiten heute so wenig wie – historisch gesehen – noch nie, wir haben also nicht weniger, sondern mehr Zeit für Introspektion, Kreativität.«
In der Tat befürchten manche Experten vor allem aus der Technologiebranche ja derzeit, dass sich genau dieser Trend fortsetzen und verstärken könnte – mit dramatischen Folgen: Titelgeschichten darüber, ob die Maschinen uns bald allen die Jobs wegnehmen, standen in den meisten großen Magazinen. Auch hier ist Salim aber optimistisch, glaubt nicht an eine durch Automatisierung ausgelöste Massenarbeitslosigkeit:
»Schauen Sie sich die Fabriken in Deutschland an – die sind inzwischen zu einem großen Teil automatisiert. Und trotzdem sind die Arbeitslosenzahlen in Ihrem Land nicht gestiegen, sondern sogar gesunken.« Automatisierung schafft neue Arten von Jobs, davon ist er überzeugt.
Was, wenn der Wandel sich so sehr beschleunigt?
Gleichzeitig steht Salim Ismail ja, wie wir gesehen haben, für die Lehre des exponentiellen Wachstums. Dieses ist am besten mit dem Gleichnis vom Schachbrett zu erklären, auf dessen erstem Feld ein Reiskorn liegt, auf dem zweiten zwei, auf dem dritten vier und so weiter. Etwa ab der Mitte des Schachbrettes werden die Zahlen so schnell so groß, dass sie sich unserer Vorstellungskraft entziehen. Und verdoppeln sich danach weiter.
Wenn es also stimmt, dass Moore’s Law auf alle möglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Felder anwendbar ist, weil immer mehr davon durch Software neu definiert wird, dann müssen wir uns also eigentlich fragen: Was, wenn wir gerade auf der Mitte des Schachbretts ankommen? Was, wenn der Wandel sich in den nächsten Jahren so sehr beschleunigt, dass wir gar nicht mehr verstehen können, was geschieht, geschweige denn es steuern?
Dann wären alle Weichen, die wir derzeit in Richtung Arbeiten 4.0 stellen – die digitalen Werkzeuge, die offenen Büros, die flachen Hierarchien –, nur tastende Schritte auf ein sich immer schneller drehendes Karussell zu. Gehen wir noch einen Schritt weiter, können wir nicht mehr zurück. Vielleicht wird die Fahrt großartig, vielleicht wird sie grauenvoll – das aus unserer jetzigen Perspektive vorauszusagen ist unmöglich. Wir sollten uns nur sehr gut überlegen, welchen Schritt wir machen, denn ein Zurück wird es nicht geben.
Wir müssen ihnen helfen, sie können sich nicht selbst helfen
Ismail ist sich sicher, dass vor allem unsere Organisationen nicht dafür aufgestellt sind, mit dieser Situation umzugehen: »Unsere Führungsstrukturen können nur mit der alten Welt des linearen – also langsamen und stetigen – Wandels umgehen. Aber Technologie gebiert so viele Veränderungen, dass wir schon jetzt die Fähigkeit verloren haben, diese komplett zu verstehen.«
Für ihn ist es eine Aufgabe der Individuen, den Organisationen – also vor allem Unternehmen – dabei zu helfen, dieses Phänomen zu verstehen und sich entsprechend neu aufzustellen. »Wir müssen ihnen helfen, denn sie können sich nicht selbst helfen.«
Egal, wie das ausgehen wird – klar scheint schon heute, dass auf den Einzelnen eine zunehmende Kontrolle und Verdichtung der Arbeit zukommen wird. Und zwar eine, die wir nicht einfach als unumgänglich hinnehmen sollten, sondern über die wir eine gesellschaftliche Debatte anstoßen müssen.
Radikale Revolution
Dass die Digitalisierung die Bürowelt so radikal revolutioniert wie zuvor nur die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts die Welt der Fabriken, ist ein Allgemeinplatz. Was das aber konkret bedeuten kann, beschrieben kürzlich Sozialwissenschaftler des Münchner Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung in einer Studie, für die sie drei Jahre lang die Auto-, Maschinenbau-, Elektro- und Informationstechnikbranche untersuchten.
Ergebnis: So wie die Fabrikmaschinen für das 19. und 20. Jahrhundert entscheidend waren, werden es Daten für das 21. sein. Das heiße aber eben auch: »Ähnlich wie bei der Industrialisierung der Handarbeit im 19. Jahrhundert werden nun geistige Tätigkeiten strukturiert und die Arbeitsprozesse im Büro unabhängig vom individuellen Geschick des Einzelnen organisiert.«
Dies, so die Süddeutsche Zeitung, die aus der Studie zitierte, sei die freundliche Umschreibung dafür, dass der Büromensch ganz Neues erlebt: Kam er bisher morgens in die Firma, bestimmte er oft selbst, wie er seine Tätigkeit erledigte. »Für einen Austausch mit Kollegen war ebenso Zeit wie für Beschleunigung oder Verringerung des Tempos oder Gedanken über Innovationen.«
Nun werde die Arbeit immer häufiger zum Akkord wie in der Fabrik – bei dem das Tempo vorgegeben und womöglich einfach erhöht wird, die Leistung messbar ist und der Büromensch kaum Einfluss hat. »Der Trend birgt die Gefahr digitaler Fließbänder«, so Forscher Tobias Kämpf. Diese Entwicklung sei ein Auftrag an die Politik, so die Forscher: »Gebraucht wird eine gesellschaftliche Leitorientierung, die die Menschen und ihre Rolle in der digitalen Transformation zentral stellt.«
Ich bezweifle ja, dass die Politik der richtige Adressat ist
Ich bezweifle ja, dass die Politik der richtige Adressat solcher – an sich ja richtiger – Forderungen ist. Wenn es stimmt, dass die technologische Entwicklung immer schneller voranschreitet, wenn die Arbeit dank Augmented Reality und intelligenter Assistenten zu einem permanenten, nicht mehr abstellbaren Begleiter unseres Lebens wird, dann ist das von Unternehmen wie Microsoft geforderte Konzept des Work-Life-Blending unausweichlich.
Und dann werden alle Versuche, diese Entwicklung politisch zu regulieren, immer zu spät kommen, zu kurz springen. Dazu kommt: In einer zunehmend globalisierten Wirtschaft ist es schlichtweg sinnlos, einzelne Kommunikationskanäle – gesetzlich reguliert – abschalten zu wollen. Wenn die Kollegen in anderen Zeitzonen noch oder schon wieder wach sind, werden Arbeitnehmer stets andere Wege finden, mit ihnen zu kollaborieren.
Vernetzung aller Sektoren
Dasselbe gilt für die zunehmende Verflechtung moderner Unternehmen mit vielfältigen externen Dienstleistern, Partnern, Experten, Freiberuflern. In Zeiten der Industrialisierung war es ökonomisch sinnvoll, dass Firmen möglichst viele Leistungen und Gewerke internalisierten – das sparte schlichtweg Transaktionsosten, also Geld, wie der britische Wirtschaftswissenschaftler Ronald Coase schon in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts zeigte.
Heute, in einer zunehmend digital organisierten Wirtschaft, ist es aufgrund sinkender Transaktionskosten sinnvoller, Leistungen zu externalisieren. Moderne Unternehmen sind Netzwerke und lassen sich immer weniger zentral steuern. Das gilt auch für Kommunikation und Arbeitszeiten. Dass man es trotzdem versuchen muss, dürfte klar sein, aber diese Aufgabe liegt vermutlich eher bei Tarifparteien oder in den Unternehmen selbst, nicht beim Gesetzgeber.
Linkliste:
www.su.org
http://magicleap.com
http://ieee.org
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/zukunft-der-arbeit-der-bueroalltag-wird-zur-akkordarbeit-1.3295973
1334 mal gelesen



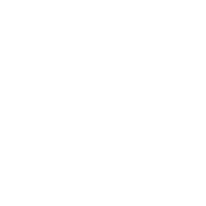

„Die Mitte des Schachbretts“ – auch für das Privateigentum an Produktionsmitteln
Merkwürdig, es wird geredet von „Disprution“, davon, dass Digi alles ändert, aber eines scheint unveränderlich in die Zukunft gedacht zu werden: Unternehmen, die über die Produktionsmittel verfügen, und Arbeitnehmer, die ihre Arbeitskraft zu Markte tragen. Und natürlich der Markt, auf dem die unsichtbare Hand …
Schon Marx war weiter. Zwar waren seine Zukunftsvorstellungen mit dem Klamauk der prol. Revolution verbunden, aber dahinter stand ja ein anderer Gedanke: wenn die Produktionsverhältnisse zur Fessel der Produktivkräfte werden, werden die Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse sprengen. Das bezog sich v.a. auf die Frage des Eigentums an den Produktionsmitteln.
Man muss es nicht in den alten Worten sagen, aber den Gedanken aufzunehmen, das scheint mir doch erwägenswert.
„Alibaba-Gründer Jack Ma hat kürzlich gesagt, die Planwirtschaft habe eine Zukunftsperspektive, weil digitale Algorithmen und künstliche Intelligenz jene unsichtbare Hand des Marktes entschlüsseln, die Angebot und Nachfrage über den Preis zusammenbringt.“
Aus einem Spiegel Interview mit Leonhard Fischer zu seinem Buch: „Es waren einmal Banker“, das Ende der Finanzwirtschaft.
Lieber Herr Unrau,
danke für den spannenden Hinweis. Ich würde das für mich in zwei Sub-Fragen umformulieren:
1) Wozu braucht es noch Unternehmen? Dass es in Zeiten der Industrialisierung ökonomisch sinnvoll war, möglichst viele Leistungen und Gewerke in Unternehmen zu internalisierten, hat der britische Wirtschaftswissenschaftler Ronald Coase ja schon in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gezeigt. Heute, in einer zunehmend digital organisierten Wirtschaft, ist es aufgrund sinkender Transaktionskosten oft sinnvoller, Leistungen zu externalisieren. Unternehmen werden zunehmend zu Netzwerken, die sich immer weniger zentral steuern lassen. Aber sie verschwinden nicht.
2) Wozu braucht es noch Geld? Mithilfe von großen Datenmengen kann der Markt künftig Angebot und Nachfrage nahezu perfekt zusammenführen, sagt Viktor Mayer-Schönberger, zusammen mit Thomas Ramge Autor des lesenswerten Buches ‚Das Digital‘. Und weiter: „Bisher ging das über den Preis, der ist ein großer Vereinfacher. Wenn wir jetzt davon abrücken und reichere Informationsflüsse zwischen Angebot und Nachfrage haben, wird das alles viel passgenauer.“ Der Markt verschwindet also nicht, er nutzt nur andere Koordinationswerkzeuge.
Sie haben einerseits Recht: Wenn Daten zunehmend zum Treibstoff der Ökonomie werden – wenn man so will: zu den Produktionsmitteln – dann stellt sich umso dringender die Frage, wer Eigentümer diese Daten ist. Deshalb von künftiger Planwirtschaft oder dem Ende des Privateigentums zu sprechen, scheint mir allerdings falsch.